Die Beratungsfirma zahlt erneut 650 Millionen Dollar, um Straf- und Zivilklagen loszuwerden. 2021 bezahlte sie schon 573 Millionen.
upg für die Online-Zeitung INFOSperber
Ein weiteres Mal zahlt McKinsey Hunderte Millionen Dollar, um Gerichtsurteile zu vermeiden. Ein Schuldeingeständnis sei es laut McKinsey nicht. Der Beratungskonzern zahlt die 650 Millionen Dollar innerhalb von fünf Jahren. Das zeigt ein Deal zwischen McKinsey und der US-Regierung, der in Gerichtsdokumenten enthalten ist. Das US-Justizdepartement informierte am 13. Dezember. Der «Spiegel» und die BBC berichteten soeben darüber.
McKinsey wurde beschuldigt, Pharmakonzerne wie Purdue Pharma beraten zu haben, wie man den Verkauf von opioidhaltigen Schmerzmitteln mit irreführenden Marketingkampagnen ankurbeln kann. Der Missbrauch von opioidhaltigen Schmerzmitteln kostete in den USA Hunderttausenden Menschen das Leben.
Das US-Justizdepartement teilte mit, McKinsey habe «wissentlich, absichtlich und kriminell» bei der «falschen Vermarktung verschreibungspflichtiger Medikamente» geholfen und habe für diese «Verschwörung» eine regelrechte Strategie entwickelt. Zudem habe McKinsey die Ermittlungen absichtlich behindert, indem der Konzern Dokumente beiseiteschaffte.
Es lohnt sich, die öffentliche Erklärung des US-Justizdepartements zu verfolgen:
Bereits im Februar 2021 war McKinsey einem Gerichtsurteil mit einem Vergleich zuvorgekommen. Der Beratungskonzern erklärte sich bereit, Ansprüche in 47 US-Bundesstaaten, fünf US-Territorien und dem District of Columbia mit einer Zahlung von 537 Millionen Dollar aus der Welt zu schaffen.
Unter dem Titel «McKinsey mischte beim US-Opioid-Skandal von Anfang an mit» hatte Daniela Gschweng auf Infosperber darüber berichtet. Im Folgenden eine Zusammenfassung.
Der Beratungskonzern war in jeder Stufe der Opioid-Lieferkette aktiv beteiligt – bis hin zur gesetzlichen Regulierung. Wenn von «Opioid-Epidemie» die Rede war, ging es meist um das Unternehmen Purdue Pharma, von dem das Schmerzmittel OxyContin stammt. Gelegentlich wurde auch das Beratungsunternehmen McKinsey erwähnt. Doch wie stark McKinsey als Beraterin involviert war, war bisher nicht bekannt.
Für die Opioid-Krise verantwortlich waren viele Hersteller, Zulieferer, Pharmafirmen und die Regulierungsbehörde FDA (Food and Drug Administration), welche die Gefahren lange nicht kommen sah. McKinsey war bei fast allen als Beraterin mit dabei. Der Konzern mischte auch bei der FDA-Zulassung der neuen OxyContin-Rezeptur mit.
Es waren nicht die Behörden, sondern die Journalisten Chris Hamby und Michael Forsythe, welche die Aufträge McKinseys für die «New York Times» (NYT) recherchiert hatten.
Sie durchsuchten mehr als 100’000 Dokumente aus 15 Jahren, die sogenannten «McKinsey Papers». Dabei handelt es sich um Unterlagen, die McKinsey im Zuge einer Gerichtsverhandlung veröffentlichen musste.
2021 bezahlte McKinsey für die folgenreiche Beratung von Purdue Pharma und seine Mitwirkung an der Krise 573 Millionen Dollar in einem Vergleich und entging damit einem Schuldeingeständnis. Opioidhaltige Schmerzmittel haben in den USA Millionen süchtig gemacht und forderten eine halbe Million Menschenleben.
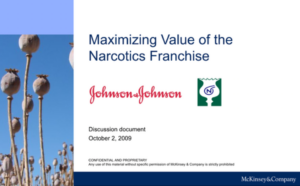
Deckblatt einer Präsentation von McKinsey für Johnson&Johnson 2009.
McKinsey beriet nicht nur die Pharmafirmen Purdue und Endo, sondern auch den größten US-Generika-Hersteller Mallinckrodt sowie Johnson & Johnson. Dessen Tochtergesellschaft Tasmanian Alkaloids war der größte Lieferant der Mohn-Rohstoffe. McKinsey-Berater arbeiteten auch für die Zulassungsbehörde FDA, wobei es Interessenkonflikte gab (Infosperber berichtete).
Sogar an Projekten, welche die Eindämmung der Opioid-Abhängigkeit zum Ziel hatten, nahm McKinsey teil – und teilte intern Dokumente mit Beratern, die für Opioid-Hersteller tätig waren.
Schäden durch «verbesserte» Rezeptur
Zurück zum Pharmaunternehmen Endo, das es Purdue nachmachte und ebenfalls ein Medikament auf den Markt brachte, das schwerer zu zerkleinern und dadurch weniger leicht zu schnupfen und deshalb zum Injizieren verführte. 2012 wurde die neue Rezeptur zugelassen, zwei Jahre nach dem Pendant von Purdue.
Kurz danach tauchten die ersten Patienten auf, die Opana injiziert und Schäden davongetragen hatten. Verursacht hatte sie ausgerechnet ein Stoff, der die Pillen schlechter zerkleinerbar machen sollte. Ein größerer Teil der Abhängigen hatte sich wegen dieser Schwierigkeit fürs Injizieren entschieden.
2013 stellte Endo einen neuen Geschäftsführer ein. Der Opana-Umsatz stieg, die Profite wuchsen auch. Endo wurde der größte Opioid-Generika-Hersteller der USA. Unter anderem, weil der neue Geschäftsführer den Firmensitz nach Irland verlegte und Endo deshalb weniger Steuern zahlte. Bemerkenswert war sein CV: Rajiv De Silva war ehemalige Führungskraft in der Pharmasparte von McKinsey.
2015 brachten Wissenschaft und US-Regierung Opana offiziell mit einer seltenen Blutkrankheit, Nierenschäden und einem größeren HIV-Ausbruch in Verbindung. Ein Nierenspezialist, den die NYT fragte, nannte Patienten mit einschlägigen Symptomen schlicht «Opana-Patienten», was zeigt, wie häufig sie waren.
McKinsey blieb davon anscheinend ungerührt und begann im selben Jahr eine Sales-Offensive für Endo. «Auf Wunsch des Kunden», sagte ein Sprecher zur NYT, «nicht auf unsere Empfehlung hin».
2017 nahm die FDA Opana wegen der gravierenden gesundheitlichen Folgen der Abhängigkeit vom Markt. Ein Schritt, den die Behörde nur sehr selten macht.












