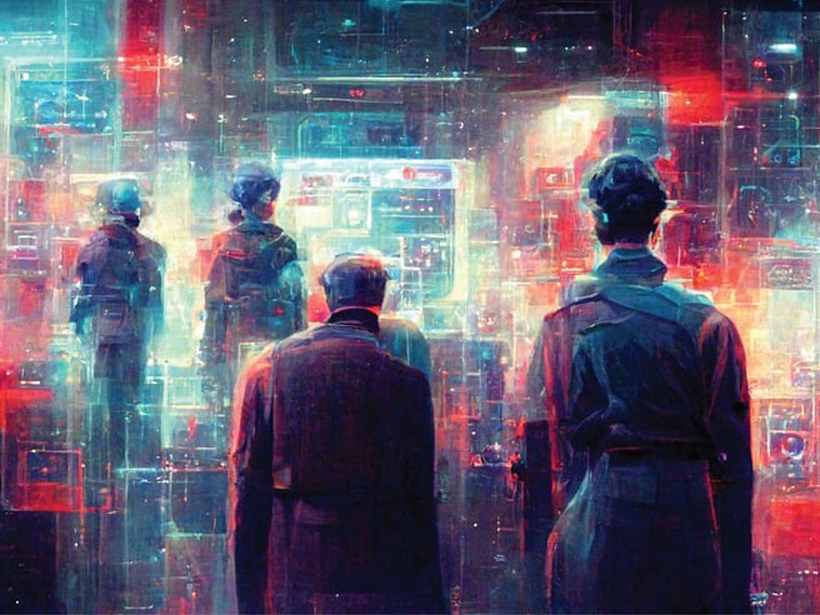Die Hoffenden sind die Revoltierenden, ganz gleich in welcher Form. Mal treten sie in Form von Traktorendemos in Erscheinung, mal lassen sie sich von Ordnungshütern friedlich wegtragen, mal setzen sie Maschinen in Brand. Alle haben sie eines gemeinsam: die anerkannte Ordnung des gültig Seienden.
Die Ordnung hüten
Die Revoltierenden möchten diese Ordnung verändern, vielleicht gar umstürzen, nicht aber das Seiende; die Ordnungshüter hingegen hüten die Ordnung vor Veränderung oder Umsturz. Vom Seienden wissen sie nichts. Was wie zwei Fronten erscheint, ergänzt sich nahtlos. Die einen könnten ohne die anderen nicht sein. Die Revoltierenden brauchen die Polizisten als Repräsentanten der bekämpften Ordnung, die Polizisten wären ohne die Revoltierenden arbeitslos – zumindest dann, wenn man all jene zu den Revoltierenden zählt, welche die gültigen Gesetze nicht respektieren und sich außerhalb davon bewegen oder sogar eingerichtet haben.
Die sogenannten „Blasen“, die sozialen Echokammern unserer Gesellschaft, funktionieren ganz ähnlich. Auch sie sind Wärmestuben der Hoffnung; wohlabgegrenzt gegeneinander gehören sie doch derselben Gesellschaft an, dem gleichen Paradigma, dem gleichen Sinn, nämlich der Annahme, gesellschaftliche Wohlfahrt sei durch immer mehr Innovation und Technik, immer mehr Konsum und/oder Fortschritt erreichbar. Was auch immer das bedeuten mag, nur eines bedeutet es sicher nicht: Verzicht. Auch in Biomärkten wird konsumiert, auch Biobaumwolle lässt sich konsumieren und mit E-Mobilität dämmern schon die nächsten, staatlich protegierten Konsumhorizonte auf.
Den Sinnhorizont verschieben
Für einen grundlegenden Wandel hieße es, alle konventionelle Hoffnung fahren zu lassen, Hoffnung also, wie sie uns von Kindesbeinen an eingeimpft wurde. Denn Hoffnung ist ja nichts Allgemeingültiges. Kinder hoffen anders als Jugendliche, Jugendliche anders als Erwachsene, Gesunde anders als Kranke, Junge anders als Alte, Tiere anders als der Homo sapiens, Pflanzen anders als Tiere. Ja, auch Pflanzen und Tiere hoffen auf eine Existenz ohne Leid. Sehr viel mehr tun auch wir nicht.
Sobald wir der konventionellen Hoffnung den Laufpass gegeben haben, können wir uns, endlich frei, nach neuen, weniger eifersüchtigen Geliebten umschauen: nach zukunftsfreundlichen, anschlussfähigen Paradigmen. Das können auch indigene oder spirituelle – am besten beides – Weltwahrnehmungen sein. Wie auch immer: Es gilt, den Sinnhorizont zu verschieben. Der hoffnungsvollste Ansatz in meiner Wahrnehmung ist der regenerative Ansatz, der gedanklich und ökologisch weit über den Nachhaltigkeitsansatz hinausreicht bzw. diesen zukunftsweisend weiterführt. Vertreten wird er unter anderem von Nate Hagens, Jascha Rohr, Geseko von Lüpke, Vandana Shiva, Daniel Christian Wahl, Andreas Weber, Maja Göpel und Martin Grassberger.
Vorbild: die allgemeinen Prinzipien des Lebens
Während z. B. der ökologische Anbau sich an natürlichen Vorgängen orientiert, etwa was die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit angeht – also ein durchaus sinnvolles Vorgehen –, schürft der regenerative Ansatz tiefer, nämlich bis zu den allgemeinen Prinzipien des Lebens. Die Idee der Nachhaltigkeit besteht im Wesentlichen darin, das Vorhandene nicht kaputtgehen zu lassen, sondern zu erhalten. Auch gut. Doch die Natur tut nicht nur das, sondern regeneriert sich; sie vertieft, erweitert und diversifiziert das Lebendige ununterbrochen. Wäre dem nicht so, gäbe es heute nur Algen und kein weiteres Leben auf diesem Planeten, also weder Pflanzen noch Tiere, keine Blume und weder dich noch mich. Die regenerativen Prozesse in der Natur schaffen immer wieder Neues, probieren es aus, verbessern es oder verwerfen es auch, nur um gleich das nächste und übernächste Experiment zu starten.
Daraus zu lernen, sich auf keine vorgekaute Hoffnung, keine felsenfesten Glaubenssätze und Ideologien zu versteifen, sondern einfach zu schauen: Funktioniert das? Und wenn nicht, dann weg damit. Und gleich mit etwas Neuem experimentieren. Und mit „neu“ meine ich „neu“ und nicht „verbessert“. Kein verschlimmbesserndes Reförmchen à la Bürgergeld statt Hartz IV, sondern echte mitmenschliche Solidarität; kein Parlamentarismus mit einem Edelreiser à la Bürgerparlament, sondern eine Demokratie für alle Lebewesen. Ich weiß, das klingt radikal und ist auch radikal gemeint. Solange wir nicht an die Wurzeln gehen, wird alles bleiben, wie es ist, nur eben allmählich schlimmer, bis es kracht. Man sollte sich nicht täuschen; das, was Bert Brecht bezüglich des ultrarechten Gedankenguts formulierte – „Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch“ –, gilt erst recht für das Patriarchat und seinen Erbprinzen, die Naturverachtung.
Dass die westliche Industriegesellschaft im Weltmaßstab nicht funktioniert, hat sie lange genug bewiesen. Also weg damit und etwas Neues ausprobieren. Das „weg damit“ beinhaltet aber eben auch unser aller Gedanken- und Gefühlsvorrat, der diese ökologische Misswirtschaft nährt und willig am Laufen hält. Erst wenn wir diesem Un-Sinn die mentale Grundlage entzogen haben – nämlich den Glauben, er sei sinnvoll –, auch den Wunsch, weiterhin davon zu profitieren, erst wenn wir diese schädliche und schändliche Hoffnung fahren lassen, besteht Grund zu neuer Hoffnung, die dann vielleicht eine regenerative Hoffnung ist.
Die Hoffnung ist kein Zustand
Aber kann Hoffnung schändlich sein? Selbstverständlich kann sie das. Wenn z. B. ein Formel-1-Rennfahrer hofft, dass dem Konkurrenten ein Reifen platzt, dann ist das eine schändliche Hoffnung. Und wenn ein Soldat hofft, der Gegner möge auf den Hinterhalt hereinfallen, damit er ihn mit einer Gewehrgarbe niedermähen kann, dann ergänzen sich das Schädliche und das Schändliche auf beispielhafte Weise. Dann ist es auch vollkommen egal, welcher Nation der Hoffende angehört. Wer so hofft, den würde ich mir nicht zum Freund wünschen.
Wie muss man sich eine regenerative Hoffnung vorstellen? Zunächst – und das dürfte der wichtigste Aspekt sein – ist sie kein Zustand, sondern ein Prozess. Mindestens einmal im Jahr erneuert – regeneriert – sich jedes unserer Ökosysteme: die Teiche und Seen, die Wälder, die Sümpfe, die Bergwiesen. Im Frühling sehen sie ähnlich aus wie im Frühling zuvor, aber in keinem Frühling sind sie sich gleich. Und wenn ein Sturm eine Schneise durch den Nadelwald gezogen hat, dann keimen dort im Folgejahr mehr Pflanzenarten als zuvor, können dort mehr Insekten und Vögel Nahrung finden.
So sei auch unsere Hoffnung: kein eingefahrenes Gedankenkarussell, sondern ein pulsierendes System neuer Ideen, Menschen, Beziehungen und Vernetzungen. Ein Fluss und keine Höhle, um in schlechten Zeiten zu überwintern. Wäre Jesus ein Prophet des regenerativen Paradigmas gewesen, er hätte uns bestimmt aufgefordert: „Werdet wie die Kinder!“