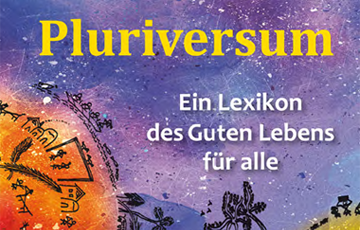Führende deutsche Tageszeitung plädiert für Ausstieg aus dem Zwei-plus-vier-Vertrag, um Deutschlands nukleare Aufrüstung zu ermöglichen. Bundeswehrexperten wollen „moralische Reflexe“ der Bevölkerung überwinden.
Eine führende deutsche Tageszeitung plädiert, um die nukleare Aufrüstung der Bundesrepublik zu ermöglichen, für einen „Ausstieg aus dem Zwei-plus-vier-Vertrag“. „Deutsche Wehrhaftigkeit gebiete“ dies, heißt es in einem Leitkommentar der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der dabei Bezug auf die Tatsache nimmt, dass der Vertrag Berlin nicht nur die Beschaffung von ABC-Waffen untersagt, sondern auch die Aufstockung des Personalbestandes der Bundeswehr auf mehr als 370.000 Soldaten. Das Plädoyer erfolgt, während Experten bestätigen, die Bundesrepublik sei technologisch fraglos in der Lage, Atombomben und nuklear bestückbare Marschflugkörper zu bauen. Unklar sei lediglich, wo man die unumgänglichen Atomtests durchführen könne. Manche weisen darauf hin, dass der ebenfalls erforderliche Ausstieg aus dem Atomwaffensperrvertrag weitreichende globale Folgen haben könne; nicht nur Iran und Saudi-Arabien, auch Südkorea und Polen dächten in diesen Tagen über eine nukleare Aufrüstung nach. Umfragen zeigen, dass die Zustimmung der Bevölkerung zunimmt, aber bisher noch in der Minderheit ist. Aus der Bundeswehr heißt es, man müsse „moralische Reflexe“, die dafür verantwortlich seien, überwinden.
Technologisch machbar
Dass Berlin technologisch in der Lage wäre, in überschaubarer Zeit eigene Atomwaffen zu fertigen, gilt unter Experten trotz des deutschen Atomausstiegs als ausgemacht. Die zur Urananreicherung nötige Technologie ist, so heißt es einhellig, in den Forschungszentren in Jülich und in Gronau vorhanden. Unumgänglich sei wohl der Bau einer deutlich größeren Anlage zur Urananreicherung, urteilen Experten; damit jedoch werde man ohne weiteres in der Lage sein, „die erforderliche Menge für einige Atomsprengköpfe in drei bis fünf Jahren“ zu produzieren, wird Rainer Moormann, ein ehemaliger Mitarbeiter des Jülich Research Centers, zitiert.[1] Probleme könne es bei den Tests geben, die man durchführen müsse. Ein unterirdischer Test in Europa sei schlicht nicht vermittelbar; wohin man ausweichen könne, sei ungewiss. Es komme hinzu, dass man Raketen benötige, um die Atomwaffen an ihr Ziel zu befördern. Beim Bau weitreichender ballistischer Raketen aber sei die Bundesrepublik relativ schlecht aufgestellt. Machbar scheine es freilich, Marschflugkörper herzustellen, die sich nuklear bestücken ließen. Aufbauen könne man etwa auf dem Taurus, heißt es. Auch dafür wird ein Zeitraum von maximal fünf Jahren als durchaus realistisch eingestuft.[2]
Rechtlich möglich, politisch riskant
Schwieriger ist die rechtliche und politische Lage. Zum einen hat die Bundesrepublik – wenn auch mit erheblicher Verzögerung (german-foreign-policy.com berichtete [3]) – am 2. Mai 1975 den Atomwaffensperrvertrag ratifiziert. Ihn müsste die Bundesregierung also, wollte sie in den Bau eigener Kernwaffen einsteigen, zuvor kündigen. Dies wäre rein juristisch ohne weiteres möglich, hätte allerdings gravierende politische Folgen – denn weitere Staaten könnten es Deutschland gleichtun und ihrerseits Atombomben zu beschaffen suchen. Bereits seit Jahrzehnten gilt Iran als einer der wichtigsten Kandidaten dafür. Saudi-Arabien, Irans schärfster regionaler Rivale, hat mittlerweile ebenfalls nukleare Ambitionen erkennen lassen. Auch Südkorea zieht inzwischen den Bau von Kernwaffen in Betracht; entsprechende Überlegungen, die im vergangenen Jahr international auf ernste Kritik gestoßen waren, seien angesichts der offen zutage tretenden Unzuverlässigkeit der Vereinigten Staaten „nicht vom Tisch“, heißt es in Seoul.[4] Überlegungen, nuklear aufzurüsten, werden inzwischen sogar in weiteren europäischen Staaten angestellt. So teilte Polens Ministerpräsident Donald Tusk kürzlich mit, auch Warschau schließe die Beschaffung von Kernwaffen nicht aus.[5]
Der Zwei-plus-vier-Vertrag
Zum anderen steht einer nuklearen Aufrüstung Deutschlands der Zwei-plus-vier-Vertrag entgegen, in dem die Bundesrepublik ihren Verzicht auf ABC-Waffen bestätigt und zugleich eine Obergrenze von 370.000 Bundeswehrsoldaten anerkannt hat. Der Vertrag kann nicht gekündigt werden; für seine Änderung wäre eine Einwilligung aller vier Hauptalliierten des Zweiten Weltkriegs erforderlich. Der deutsche Diplomat Ernst-Jörg von Studnitz, ein früherer Botschafter in Russland, urteilte kürzlich, man könne sich auf den Völkerrechtsgrundsatz clausula rebus sic stantibus berufen; demnach seien Vertragsbestimmungen „kündbar, wenn sich die grundlegenden Voraussetzungen, unter denen ein Vertrag geschlossen wurde, geändert haben“.[6] Dies sei, da der US-Nuklearschirm nicht mehr als zuverlässig gelten könne und der Konflikt mit Russland eskaliert sei, aus deutscher Sicht der Fall. Den Kern der Argumentation hat sich am gestrigen Montag die Frankfurter Allgemeine Zeitung in einem weithin rezipierten Leitkommentar zu Eigen gemacht. Es gebe „gute Gründe“, heißt es darin, „von einem Wegfall der Grundlage für den Zwei-plus-vier-Vertrag zu sprechen“. So könne eine „Bindung“, die „dem Land schadet“, „keinen Bestand haben“.[7] Deutschland, so überschreibt die Zeitung den Kommentar, „muss alte Fesseln lösen“.
Immenses Erschütterungspotenzial
Das politische Erschütterungspotenzial, das eine Kündigung des Zwei-plus-vier-Vertrags mit sich brächte, wäre immens. Nicht nur, dass eine nukleare Bewaffnung der Bundesrepublik bei den vier ehemaligen Weltkriegsalliierten heftige Reaktionen auslösen könnte, wenn auch aus jeweils unterschiedlichen Gründen. Der Zwei-plus-vier-Vertrag enthält auch Regelungen zum deutschen Staatsgebiet respektive zu den deutschen Grenzen. Erklärt Berlin, sich nicht mehr an den Vertrag halten zu wollen, entfällt ein wichtiger Anker der Nachkriegsordnung in Europa.
Zustimmung steigt
Nicht nur im Ausland, auch im Inland wären noch einige Hürden zu überwinden, entschiede sich die Bundesregierung, auf einen Erwerb eigener Atomwaffen zu setzen. Noch spricht sich eine klare Mehrheit der Bevölkerung gegen ein solches Vorhaben aus. Allerdings schwanken die Ergebnisse unterschiedlicher Umfragen deutlich; zudem nimmt die Abneigung gegenüber einer deutschen Bombe ab. So ergab eine Forsa-Umfrage vor rund zweieinhalb Wochen, dass 64 Prozent der Bevölkerung die nukleare Bewaffnung der Bundesrepublik ablehnen. Nur 31 Prozent sprachen sich dafür aus. Das waren allerdings schon vier Prozentpunkte mehr als 2024.[8] Eine zur selben Zeit erhobene Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey kam zu dem Resultat, dass nur 48 Prozent der Bevölkerung einer deutschen Bombe eine klare Absage erteilen. Ein Jahr zuvor waren es noch 57 Prozent gewesen. Der Anteil derer, die sich für den Erwerb deutscher Kernwaffen aussprachen, stieg und erreichte bereits 38 Prozent.[9] Beide Umfragen belegen darüber hinaus: Der Anteil derjenigen, die die nukleare Bewaffnung Deutschlands befürworten, ist im Westen Deutschlands – in der alten BRD – erheblich höher als in der ehemaligen DDR.
„Moralische Reflexe“
Wohl auch mit Blick auf die zwar steigende, aber immer noch unzureichende Unterstützung der Bevölkerung für eine nukleare Aufrüstung urteilten am gestrigen Montag zwei Mitarbeiter der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg in einem Beitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die deutsche Debatte über Kernwaffen sei „noch immer von moralischen Reflexen und historisch tradierten Narrativen geprägt“.[10] Demgegenüber müsse „eine nüchterne Neubewertung“ der „Thematik“ vorgenommen werden. So sei es etwa wichtig, „staatliche Funktionen“ auch „nach einem nuklearen Angriff aufrechtzuerhalten“. Wolle man dies sicherstellen, müsse man die aktuelle Debatte „um die wichtigen Aspekte von Zivilschutz und gesellschaftlicher Resilienz“ erweitern. Die deutsche Bevölkerung müsse es lernen, „mit der Bombe zu leben“; dazu bedürfe es „einer umfassenden, gesellschaftspolitisch verankerten Strategie, die die einschlägigen militärischen, politischen und sozialen Dimensionen integriert“. Kurz, es gelte, „die eigene Bevölkerung“ von der Notwendigkeit der nuklearen Aufrüstung und des Ertragens der Folgen „zu überzeugen“. Diese Aufgabe kommt traditionell den Leitmedien zu.
[1], [2] Gernot Kramper: Eine deutsche Bombe? stern.de 09.03.2025.
[3] S. dazu Die „Atom-Supermacht Europa“.
[4] Richard Lloyd Parry: South Korea says nuclear weapons are ‘not off the table’. thetimes.com 02.03.2025. S. auch Blockbildung in Ostasien (II).
[5] Reinhard Lauterbach: Polen will die Bombe. junge Welt 17.03.2025.
[6] Ernst-Jörg von Studnitz: Leserbrief: Der Weg für eine deutsche Nuklearoption. Frankfurter Allgemeine Zeitung 14.03.2025.
[7] Reinhard Müller: Deutschland muss alte Fesseln lösen. Frankfurter Allgemeine Zeitung 24.03.2025.
[8] Lorenz Wolf-Doettinchem: Sollte Deutschland zum Schutz vor Putin eigene Atombomben bauen? stern.de 11.03.2025.
[9] Umfrage zeigt Wende bei Zustimmung zu Atomwaffen. t-online.de 10.03.2025.
[10] Michael Jonas, Severin Pleyer: Die Bombe verstehen lernen. Frankfurter Allgemeine Zeitung 24.03.2025.