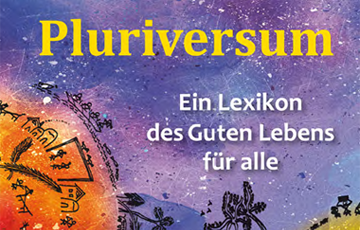Luftverschmutzung ist das größte umweltbedingte Gesundheitsrisiko in der EU. Jährlich sterben rund 240.000 Menschen frühzeitig an den Folgen einer zu hohen Feinstaubbelastung. Besonders betroffen sind die schlechter gestellten Bevölkerungsschichten. Sie leben häufig dort, wo die Luft am dreckigsten ist.
von Ralf Waldhart
Spaziert man am Gürtel in Wien entlang, versinkt man in einer Welt von Tristesse, Autolärm und Abgasen. Die Autos stauen sich hier tagtäglich über die mehrspurigen Straßen. Jegliche Farbe scheint von einem dreckigen Grau verschluckt zu werden. Schön ist das nicht. Gesund natürlich auch nicht.
Doch für viele ist dieser Ort Zuhause und Lebensmittelpunkt. Sie wohnen hier, treffen sich mit Freundin:innen und machen Sport in den „Käfigen“, die auf den wenigen Grünstreifen zwischen den Fahrbahnen stehen. Die Gefahr, die von Feinstaub ausgeht, ist ihnen vermutlich nicht bewusst. Die Frage, ob sie hier sein möchten oder nicht, stellt sich ihnen aber ohnehin nicht. Ihr sozio-ökonomischer Status, also Einkommen, Bildungsniveau und/oder der Beschäftigungsstatus, zwingt ihnen solche Orte häufig als Lebensmittelpunkt auf. Denn nahe den viel befahrenen Straßen oder der Industrie sind die Mieten meist niedriger – und die Luft dreckiger.
Schlechte Luft tötet
Feinstaub, das sind winzige Staubteilchen, die in der Luft schweben. Grob lässt sich sagen: je kleiner die Partikel, desto schädlicher sind sie für unsere Gesundheit. Sie können chronische Erkrankungen verursachen und führen im schlimmsten Fall zum Tod. In der EU sterben jährlich immer noch rund 240.000 Menschen an den Folgen einer zu hohen Feinstaubbelastung. Etwa 3.320 davon in Österreich. Das macht die Luftverschmutzung zum größten umweltbedingten Gesundheitsrisiko für Menschen in der Europäischen Union.
Während der „grobkörnige“ Feinstaub (PM10 genannt) häufig schon in der Nase “hängen” bleibt, schafft es der kleinere PM2,5 bis tief in unsere Lungen und setzt sich dort in Bronchien und Lungenbläschen fest. Noch drastischer sind die Auswirkungen von Ultrafeinstaub. Er kommt vor allem in Dieselruß vor und wird von der WHO als krebserregend eingestuft. Er kann bis in unser Blut oder das Lymphsystem vordringen. Das ist eine Gefahr – für alle Menschen, aber besonders für Kinder, Schwangere, Menschen mit Atemwegserkrankungen und ältere Personen.
Bei kurzfristiger Belastung kann er unter anderem zu Bluthochdruck führen oder einen vorher geschwächten Körper überfordern. Ist man der Luftverschmutzung über Monate oder Jahre ausgesetzt, kann das zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Asthma, Lungenkrebs oder einem erhöhten Risiko für Herzinfarkte führen. Außerdem steigt das Risiko, an Diabetes oder Demenz zu erkranken.
Grenzenlose Richtwerte
2024 war die Luft so sauber wie schon lange nicht mehr. Der langfristige Trend geht in die richtige Richtung. Von gesunder Luft kann aber noch lange keine Rede sein. Vor allem in und um städtische Gebiete ist die Belastung durch Feinstaub oft hoch.
Schädlich ist Feinstaub aber immer. Egal in welcher Größe oder Menge. Das hat auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) festgestellt und deshalb dazu aufgefordert, die Belastung so gering wie möglich zu halten. Um das sicherzustellen, hat sie Richtwerte festgesetzt, die gesundheitsschädliche Effekte minimieren sollen. Die EU ist nachgezogen und hat ihre eigenen Grenzwerte bestimmt. Sie liegen allerdings deutlich über jenen der WHO.
Im Zuge des Green New Deal will sich die Europäische Union bis 2050 den WHO-Vorgaben aber zumindest annähern. Um dieses Ziel zu erreichen, gilt seit Dezember 2024 die Luftqualitätsrichtlinie. In einem ersten Schritt sollen so die Grenzwerte unter anderem für Feinstaub bereits bis 2030 deutlich gesenkt werden. In Österreich wird die Einhaltung dieser Grenzwerte an 135 Messstellen überwacht.
Der Ausstoß von Feinstaub ist in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Dennoch: 2024 wurden die Werte der neuen EU-Luftqualitätslinie hierzulande bei einigen Messstellen überschritten. Die WHO-Empfehlungen, sogar bei 80 Prozent.
Feinstaubquelle Mensch
Der größte Verursacher von Feinstaub ist der Mensch selbst. Im Straßenverkehr kommt der Feinstaub aus den Auspuffen jedes einzelnen Verbrenner-Motors. Aber auch immer dann, wenn sich Reifen und Straße reiben oder eine Bremse betätigt wird, entsteht er – selbst bei E-Autos. Feinstaub kommt aus alten Heizungen oder Öfen, die mit Holz und Kohle befeuert werden. Er entsteht in Gewerbe, Industrie und in Abfallverbrennungsanlagen. Und auch aus Gülle, die in der Landwirtschaft durch Massentierhaltung anfällt, entsteht Feinstaub.
Was kann man gegen Feinstaub tun?
Die Anpassung der Richtlinien an die WHO-Grenzwerte ist ein guter erster Schritt in die richtige Richtung. Die Luft macht das aber noch nicht besser. Dafür müssen Taten folgen.
Zum Beispiel in der Verkehrspolitik. Die müsste endlich nachhaltiger gestaltet werden, ohne das Auto weiterhin in den Mittelpunkt der Mobilität zu stellen – egal ob mit Verbrenner- oder E-Antrieb. Was es wirklich braucht, wäre eine Verkehrswende, die den PKW-Verkehr nachhaltig verringert und Fußgänger:innen und Radfahrer:innen stärker in den Vordergrund rückt. Es braucht ein verbindliches Aus fossiler Heizungen und klare Richtlinien für die Industrie, um Emissionen einzusparen. Kurz gesagt: Überall, wo Feinstaub verringert werden kann, müssen wir das tun.
So können wir die Luftverschmutzung nachhaltig bekämpfen und die allgemeine Lebensqualität verbessern. Für alle. Vor allem aber für jene Mitmenschen, die an den viel befahrenen Straßen dieses Landes leben müssen.