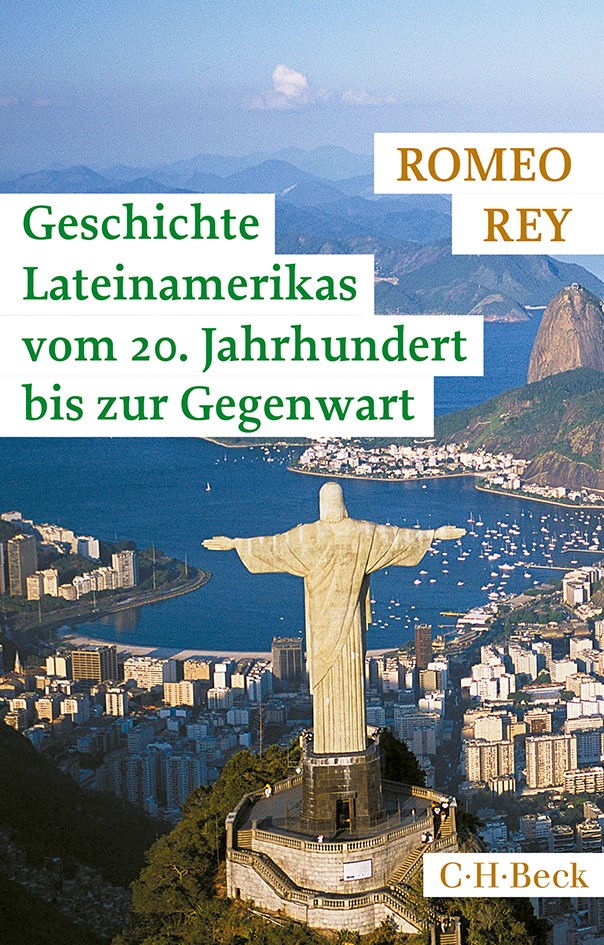Romeo Rey, früher Lateinamerika-Korrespondent von Tages-Anzeiger und Frankfurter Rundschau, fasst die jüngste Entwicklung zusammen.
Der Umsturz in Peru ist ein Zeichen dafür, dass der gegenwärtige Trend zugunsten der Linken in Lateinamerika nicht in Stein gemeisselt ist. Nach eineinhalbjähriger, zunehmend wackliger Herrschaft ist Präsident Pedro Castillo vom Parlament «wegen Unfähigkeit in der Amtsführung» entmachtet worden. Die Nachfolge wurde vorderhand der verfassungsmässigen Vizepräsidentin Dina Boluarte überlassen. Sie gehörte zwar ursprünglich derselben «Peru Libre»-Partei an wie der gefallene Staatschef, hatte diese jedoch nach kurzer Zeit verlassen und steht heute ohne zählbaren Rückhalt im Parlament da. Wie lange sich die 60-jährige Juristin als Staatsoberhaupt halten kann, steht in den Sternen.
Dass Castillos Regentschaft überhaupt so lange dauern konnte, ist schon fast als Überraschung zu werten. Der Volksschullehrer aus dem Norden Perus hatte 2021 den Kampf um die Gunst der Stimmberechtigten mit dem einzigen konkreten Versprechen geführt, die galoppierende Korruption im Land auszurotten. Als sich dieses nach kurzer Zeit als leere Formel erwies, die nicht einmal in seinem nächsten Umfeld befolgt wurde, war es um ihn geschehen. Die Orientierungslosigkeit seiner Regierung kam auch darin zum Ausdruck, dass er die Mitglieder seines Kabinetts in rascher Folge verheizte und durch neue, ebenso unbekannte und für ministeriale Ämter kaum qualifizierte Personen ersetzte, die jeweils nur kurz im Amt blieben.
Wer Hoffnungen auf die Legislative des Andenstaats setzt, wird seit mindestens zwei Jahrzehnten immer wieder enttäuscht. Der Ruf vieler Kongressmitglieder ist miserabel, eigennützige Überlegungen verhindern das Zustandekommen von Koalitionen. Dadurch wird das Regieren für Präsidenten durch politisch motivierte Obstruktion erschwert, wenn nicht gar verhindert. Das hat Castillo massiv zu spüren bekommen, und auch Dina Boluarte, in Peru die erste Frau in diesem Amt, dürfte es schwer haben.
Castillo hatte 2021 bei der Stichwahl um die Präsidentschaft der Republik um Haaresbreite gegen Keiko Fujimori gewonnen. Das sollte jedoch der einzige Triumph in seiner kurzen politischen Karriere bleiben. Zwei Misstrauensvoten im Parlament konnte er nur knapp abwenden. Einen weiteren Versuch, ihn zum Rücktritt zu zwingen, wollte er mit der Schliessung des Kongresses und mit Neuwahlen kontern. Obwohl das mit gewissen Restriktionen möglich gewesen wäre, brachte es ihm prompt die Anklage eines versuchten «Eigenputsches» ein, wie ihn Alberto Fujimori 1992 praktiziert hatte.
Lulas Sisyphusarbeit beginnt am 1. Januar
Unter verschiedenartigen Umständen droht sich das Schicksal Castillos in anderen Ländern Lateinamerikas zu wiederholen. Im Falle von Brasilien scheint zwar der Machtwechsel vom Rechtspopulisten Jair Mesías Bolsonaro zum gemässigt linksgerichteten Expräsidenten Lula da Silva gesichert zu sein. Die Amtsübertragung soll traditionsgemäss am 1. Januar stattfinden. Aber einige wichtige Fragen sind noch offen. Ungewiss ist, ob und wie Bolsonaro bei diesem Akt präsent sein wird, um seinem Rivalen und Nachfolger die Ehre zu erweisen – oder eben nicht.
Zwei grundverschiedene Quellen (hier und hier) befassen sich im deutschsprachigen Raum mit den politischen Perspektiven nach der Rückkehr des langjährigen Chefs der Arbeiterpartei an die Schalthebel der Macht. Beide Kommentare konzentrieren sich dabei auf die Frage, ob und wie weit der «Bolsonarismo» nach der Niederlage ihres Führers an den Urnen die Geschicke im grössten Staat des Subkontinents weiterhin beeinflussen kann. Bisher hat sich in der Geschichte Brasiliens nur einer selbst überlebt, und das war Getúlio Vargas. Er brachte es nach langer Herrschaft in der Zeit vor und während des Zweiten Weltkriegs 1950 fertig, noch einmal vom Volk zum Staatschef gewählt zu werden. Und zwischen dem Zivilpolitiker Vargas und dem Armeehauptmann Bolsonaro liegen Welten.
In Bolivien regiert seit 2006 mit einem Unterbruch von rund einem Jahr (2019-2020) die sozial und pragmatisch orientierte MAS-Bewegung. Das ist, gerade im «Land der hundert Revolutionen», eine lange Zeit. Abnützungserscheinungen sind unübersehbar, und es fehlt auch nicht an einer Opposition, die solches ausschlachtet. Die grösste Konzentration von regierungsfeindlichen Kräften, die den sozial- und entwicklungspolitischen Kurs der MAS zu blockieren versuchen, befindet sich im östlichen Tiefland rund um Santa Cruz de la Sierra. Sie haben in den vergangenen Monaten verzweifelte Anstrengungen unternommen, um die Regierung von Präsident Luis Arce aus dem Gleichgewicht zu bringen und einen Umsturz herbeizuführen. Diese Gelüste scheinen jedoch mittlerweile im Sand zu verlaufen, was am ehesten mit dem Verhandlungsgeschick der Regierung in La Paz zu erklären ist.
Drogenkrieg in Ecuador
Ecuador war bis vor einigen Jahren relativ wenig vom Rauschgifthandel, der damit verbundenen Unterwanderung der legalen Strukturen und zunehmenden Gewalttätigkeit betroffen. Laut einem Bericht des britischen «Guardian» hat sich das inzwischen gründlich geändert. Vor allem in der Küstenregion um Guayaquil wüten schwere Bandenkriege, die auch mit der wiederholten Verhängung des Notstands durch die konservative Regierung von Präsident Guillermo Lasso nicht eingedämmt werden konnten. Allein im laufenden Jahr sollen an die 3000 Menschen, unter ihnen auch Dutzende Polizisten, eines gewaltsamen Todes umgekommen sein. In manchen Gefängnissen herrschen ähnlich mörderische Zustände wie in Brasilien oder Mexiko – ein Vergleich, der in früheren Jahren undenkbar gewesen wäre.
Schlechte Nachrichten erreichen uns – was üblicherweise eher selten vorkommt – auch aus Uruguay. In diesem fast völlig flachen Land am Rio de la Plata, das rund viermal grösser als die Schweiz ist, dessen Bevölkerung aber wegen Überalterung und Abwanderung seit vielen Jahrzehnten bei 3,5 Millionen stagniert, sind Papiere aus Geheimdienstkreisen an die Öffentlichkeit gelangt, die gewaltig Staub aufgewirbelt haben. Sie betreffen die Frage, wie die UruguayerInnen am effizientesten überwacht werden sollen. Zudem wurden andere peinliche Umtriebe aufgedeckt, die in dasselbe Gebäude im Zentrum von Montevideo führen, wo der konservative Staatspräsident Luis Lacalle Pou seine Regierungsgeschäfte erledigt. Doppelte Schmach in einem Land, das aufgrund seiner weitgehend demokratischen Strukturen als «die Schweiz Südamerikas» gilt. Nun hat also auch Uruguay eine Fichenaffäre – wie die Schweiz eine hatte.
Eine «OPEC» für Lithium
Mehrere Staaten Lateinamerikas haben sich in den vergangenen hundert Jahren jene technologischen Kenntnisse angeeignet, die zum Fördern von Erdöl und Erdgas notwendig sind. Erste Schritte in dieser Richtung unternahmen etwa um 1920 nationalistisch gesinnte Kreise der Zivilgesellschaft und des Militärs in Argentinien. Auf die Nutzung der natürlichen Ressourcen in eigener Regie bedachte Akteure folgten diesem Beispiel in Mexiko, Bolivien und etwas später in Brasilien unter Getúlio Vargas, in Venezuela und allen übrigen Ländern Südamerikas mit teils beachtlichen Erfolgen. Die US-amerikanischen Ölmultis unter Führung von Rockefellers Standard Oil Company versuchten immer wieder, die Initiativen der Nationalisten auf dem Subkontinent zu durchkreuzen. Sie konnten jedoch nicht verhindern, dass die lokalen Kräfte immer mehr Einfluss in der Nutzung dieser Ressourcen gewannen und ihre Autonomie in diesem Sektor verstärken konnten.
Ähnliche Bemühungen, was den Abbau von Lithium betrifft, zeichnen sich jetzt unter erhöhter Präsenz von linksgerichteten Regierungen in der Region ab. Allerdings haben bisher nur drei Staaten diesen neuen Reichtum auf ihrem Hoheitsgebiet entdeckt: Bolivien, Chile und Argentinien. Die grössten Vorkommen befinden sich im Schnittpunkt der gemeinsamen Grenze in der Nähe der Atacama-Wüste und des Salzsees von Uyuni. Eine Analyse der deutschen «Nachdenkseiten» beleuchtet die verschiedenen Aspekte der Nutzung und Entwicklung des begehrten Rohstoffs. Bereits ist denn auch die Rede von der möglichen Gründung einer «OPEC des Lithiums».
Wer die führende Rolle und Aufsicht beim Abbau von Lithium und der breiten Palette anderer natürlicher Ressourcen haben soll, darüber macht sich der betagte argentinische Soziologe Atilio Borón Gedanken. Er untersucht die von US-amerikanischen Geheimdiensten entworfenen Weisungen der «Nationalen Sicherheitsstrategie 2022» zuhanden der Regierung Biden, wie die Vormachtstellung Washingtons in der Welt zu konsolidieren sei. Im letzten Drittel von Boróns Bericht werden diese Pläne auf Lateinamerika bezogen. In den strategischen Richtlinien wird einmal mehr kein Zweifel offen gelassen, dass «Amerika den Amerikanern gehören» soll. Und das heisst in diesem Kontext unmissverständlich: den USA.
Lateinamerika scheint sich jedoch mit solchen Diktaten nicht mehr abfinden zu wollen. Prominente Politiker des Subkontinents rufen die demokratisch gewählten Präsidenten vom Rio Grande bis Feuerland auf, die vor Jahren unter überwiegend konservativen Regierungen auf Eis gelegte «Union südamerikanischer Nationen» (Unasur) wiederzubeleben und auf ganz Lateinamerika auszudehnen. Damit soll die Entschlossenheit dieser Völker bekundet werden, den Herrschaftsansprüchen der USA zu trotzen und die Nutzung der vielfältigen Reichtümer dieser Region im Interesse der Mehrheit ihrer Bewohner und Bewohnerinnen voranzutreiben. Konkrete Schritte in dieser Richtung unternimmt jetzt die erste Linksregierung in der Geschichte Kolumbiens. Sie will jene Leute verstärkt zur Kasse bitten, die vor allem durch gewaltsame Aneignung von Grundbesitz in der Vergangenheit reich geworden sind. Auch die im Land tätigen Erdöl- und Kohlekonzerne sollen steuerlich mehr belastet werden.
Romeo Rey, Die Geschichte Lateinamerikas vom 20. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 284 Seiten, 3. Auflage, C.H.Beck 2015, CHF 22.30